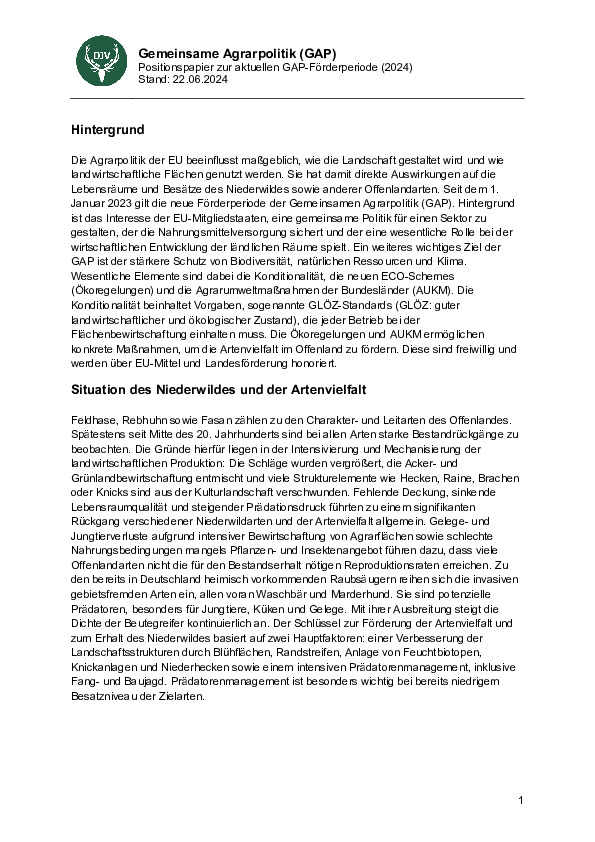DJV-Position zur aktuellen GAP-Förderperiode

Hintergrund
Die Agrarpolitik der EU beeinflusst maßgeblich, wie die Landschaft gestaltet wird und wie landwirtschaftliche Flächen genutzt werden. Sie hat damit direkte Auswirkungen auf die Lebensräume und Besätze des Niederwildes sowie anderer Offenlandarten. Seit dem 1. Januar 2023 gilt die neue Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Hintergrund ist das Interesse der EU-Mitgliedstaaten, eine gemeinsame Politik für einen Sektor zu gestalten, der die Nahrungsmittelversorgung sichert und der eine wesentliche Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung der ländlichen Räume spielt. Ein weiteres wichtiges Ziel der GAP ist der stärkere Schutz von Biodiversität, natürlichen Ressourcen und Klima. Wesentliche Elemente sind dabei die Konditionalität, die neuen ECO-Schemes (Ökoregelungen) und die Agrarumweltmaßnahmen der Bundesländer (AUKM). Die Konditionalität beinhaltet Vorgaben, sogenannte GLÖZ-Standards (GLÖZ: guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand), die jeder Betrieb bei der Flächenbewirtschaftung einhalten muss. Die Ökoregelungen und AUKM ermöglichen konkrete Maßnahmen, um die Artenvielfalt im Offenland zu fördern. Diese sind freiwillig und werden über EU-Mittel und Landesförderung honoriert.
Situation des Niederwildes und der Artenvielfalt
Feldhase, Rebhuhn sowie Fasan zählen zu den Charakter- und Leitarten des Offenlandes. Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind bei allen Arten starke Bestandrückgänge zu beobachten. Die Gründe hierfür liegen in der Intensivierung und Mechanisierung der landwirtschaftlichen Produktion: Die Schläge wurden vergrößert, die Acker- und Grünlandbewirtschaftung entmischt und viele Strukturelemente wie Hecken, Raine, Brachen oder Knicks sind aus der Kulturlandschaft verschwunden. Fehlende Deckung, sinkende Lebensraumqualität und steigender Prädationsdruck führten zu einem signifikanten Rückgang verschiedener Niederwildarten und der Artenvielfalt allgemein. Gelege- und Jungtierverluste aufgrund intensiver Bewirtschaftung von Agrarflächen sowie schlechte Nahrungsbedingungen mangels Pflanzen- und Insektenangebot führen dazu, dass viele Offenlandarten nicht die für den Bestandserhalt nötigen Reproduktionsraten erreichen. Zu den bereits in Deutschland heimisch vorkommenden Raubsäugern reihen sich die invasiven gebietsfremden Arten ein, allen voran Waschbär und Marderhund. Sie sind potenzielle Prädatoren, besonders für Jungtiere, Küken und Gelege. Mit ihrer Ausbreitung steigt die Dichte der Beutegreifer kontinuierlich an. Der Schlüssel zur Förderung der Artenvielfalt und zum Erhalt des Niederwildes basiert auf zwei Hauptfaktoren: einer Verbesserung der Landschaftsstrukturen durch Blühflächen, Randstreifen, Anlage von Feuchtbiotopen, Knickanlagen und Niederhecken sowie einem intensiven Prädatorenmanagement, inklusive Fang- und Baujagd. Prädatorenmanagement ist besonders wichtig bei bereits niedrigem Besatzniveau der Zielarten.
Niederwildrelevante Maßnahmen der aktuellen GAP
Verpflichtende Konditionalität (GLÖZ 8): Stilllegungsflächen und Ansaatbrachen (Blühflächen)
Brachen bieten seltenen Tieren und Pflanzen Schutz, ebenso Vorteile für das Niederwild: ein gutes Nahrungsangebot durch verschiedene Ackerwildkräuter und ganzjährige Deckung, die vor Prädation schützt. Durch den höheren Anteil von Insekten sind Brachen besonders in der Aufzuchtzeit für Rebhühner und Fasane geeignet. Die schüttere Vegetation verringert für den Feldhühnernachwuchs zudem die Gefahr des Verklammens. Durch das Ausbleiben der Flächenbearbeitung werden bereits die Gelege vor der Zerstörung bewahrt. Aus Sicht des Niederwildes und vieler anderer Offenlandarten haben vor allem aktiv begrünte Brachflächen die größte Bedeutung, da die Mulchverpflichtung als Mindesttätigkeit erst ab dem 16. August und nur im 2-jährigen Turnus durchgeführt werden darf. Zudem stellen Stilllegungsflächen während und nach der Ernte den einzig verbleibenden Rückzugsort dar.
Freiwillige Maßnahmen: Ökoregelungen (ÖR 1a/1b)
Mit Einführung der neuen Ökoregelungen (Eco-Schemes) in der ersten Säule der Agrarförderung können nun ein- und mehrjährige Blühflächen über die Ökoregelung 1b „Blühstreifen oder -flächen auf GLÖZ 8-Aufstockungsflächen“ gefördert werden. Die Blühflächen der Ökoregelung 1b können nur auf Flächen angelegt werden, die bereits über die Ökoregelung 1a für die Erweiterung der nicht-produktiven Ackerfläche nach GLÖZ 8 gefördert werden. Aus Sicht des Niederwildes und weiterer Offenlandarten kommt der ÖR 1b die größte Bedeutung zu, da sie ganzjährig Deckung und Nahrung schafft. Der so angelegte ganzjährige Lebensraum erfüllt in der Feldflur für eine Vielzahl an Wildtieren, Feldvögeln und Insekten vielfältige Funktionen.
Änderungen und Ausnahmen in der aktuellen GAP-Förderperiode
Bereits vor Beginn der Förderperiode lagen die größten Hoffnungen zum Wohl der Offenlandarten auf GLÖZ 8. Hierbei ist ein Mindestanteil von 4 Prozent nicht-produktiver Flächen durch die Anlage von Ackerbrachen und/oder durch Landschaftselemente zu erbringen – also eine Flächenstilllegung. Nach anfänglicher Diskussion über die Selbstbegrünung von Brachflächen, die weder ackerbaulich noch wildtierfreundlich gestaltet werden durften, wurde schließlich zusätzlich eine gezielte Begrünung zugelassen. Somit ist eine Selbstbegrünung oder eine aktive Begrünung durch Ansaat (keine landwirtschaftliche Kultur in Reinsaat) zulässig. Jedoch muss die Einsaat unmittelbar nach der Ernte der Hauptfrucht im Vorjahr erfolgen. Bereits 2023 wurden die Vorgaben zur verpflichtenden Stilllegung aber ausgesetzt und modifiziert. Aufgrund des Ukrainekriegs und dessen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit konnten die Landwirte gemäß der GAP-Ausnahme-Verordnung im Jahr 2023 die Konditionalität GLÖZ 8 aussetzen. Bei Aussetzen von GLÖZ 8 konnten jedoch im selben Jahr die ÖR 1a und 1b nicht mehr beantragt werden. Der Anbau von Sonnenblumen oder Leguminosen war zulässig. Im Antragsjahr 2024 wurde die Pflicht zur Stilllegung von mindestens 4 Prozent der Ackerflächen zur Erfüllung des GLÖZ-8-Standards ausgesetzt. Stattdessen hat die Kommission Ausnahmen geschaffen. GLÖZ-8-Standards können nun durch 4 Prozent der Ackerfläche in Form von Brachen und/oder Landschaftselementen und/oder stickstoffbindenden Pflanzen (Leguminosen) und/oder Zwischenfrüchten erfüllt werden. Leguminosen und Zwischenfrüchte dürfen dabei nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden.
Kritik:
Die von der EU-Kommission geschaffene Ausnahme ist kein Ersatz für Brachflächen. Die ursprüngliche Ausgestaltung der GLÖZ 8 wurde eingeführt, um wichtigen Lebensraum für die Artenvielfalt zu schaffen. Es ist unumstritten, dass für eine Trendumkehr beim Artensterben 10 bis 20 Prozent der Agrarfläche als attraktiver Lebensraum gestaltet werden müssen. GLÖZ 8 – mit der entsprechenden Vorschrift, vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche als Fläche für die Biodiversität vorzuhalten – ist ein erster Baustein zu diesem Ziel. Auch bereits 2023 eingesäte Brachen können zwar erhalten werden, jedoch ist aufgrund des nun möglichen Anbaus von Zwischenfrüchten zu erwarten, dass Landwirte Brachen in intensiven genutzten Ackerbaugebieten umbrechen und diese Flächen somit wieder der Nutzung zuführen. Vor allem beim Zwischenfruchtanbau ist die Standzeit auf mindestens 6 Wochen festgelegt, spätestens am 15. Oktober muss die Zwischenfrucht bestellt sein. Soll jedoch die Zwischenfrucht einen positiven Effekt auf das Niederwild und die Artenvielfalt haben, sollte die Saat bereits im August eingesät sein, um dem Niederwild ausreichend Deckung und Äsung in den Wintermonaten zu bieten. Allgemein bieten Leguminosen wie Klee eine Grünäsung für Wildtiere sowie Nektar für Insekten, sind aber kein adäquater Ersatz für Brachflächen, vor allem weil mechanische Unkrautbekämpfung (Hacken, Striegeln) zugelassen ist. Die Folge: Verluste von Junghasen.
Jagd als Instrument für das Niederwild und den Artenschutz
Intensive, moderne Landnutzung ist eine wesentliche Ursache für den Artenschwund. Der großflächige Anbau nachwachsender Rohstoffe, das wachsende Verkehrswegenetz, immer mehr Siedlungen und das Verschwinden ungenutzter Brachflächen sind negativ für die Artenvielfalt: Die Lebensräume spezialisierter Arten nehmen in ihrer Fläche und Qualität weiter ab und verinseln zusehends. Für viele Offenlandarten werden anpassungsfähige Raubsäuger wie Fuchs, Steinmarder und Neozoen (Marderhund, Waschbär) deshalb immer mehr zum Schlüsselfaktor: Diese kommen in der Kulturlandschaft bestens zurecht, vermehren sich stark und dringen in die Lebensräume seltener Arten ein. Neben der Verbesserung von Lebensräumen ist die Reduktion von Raubsäugern deshalb eine wichtige Stellschraube, um bedrohten Arten zu helfen. Deutschland ist per EU-Verordnung (EU-VO 1143/2014) zum Management von Arten wie Waschbär, Marderhund oder Nutria verpflichtet. Eine effektive Fangjagd ist für die Eindämmung dieser dämmerungs- und nachtaktiven Tiere zwingend notwendig, ihre Einschränkung schädlich für den Artenschutz.
Forderungen
- Bund und Länder müssen sich generell zur Jagd, inklusive Fangjagd, auf alle nicht ganzjährig geschonten Beutegreifer als Instrument für den Artenschutz bekennen. Dabei geht es um heimische Beutegreifer (z.B. Fuchs, Steinmarder) ebenso wie um invasive Arten (z.B. Waschbär, Marderhund). Managementmaßnahmen durch Jagd, insbesondere für invasive Arten, wie den Waschbär, müssen künftig bei Novellierungen von Landesjagdgesetzen umgesetzt werden. Bund und Länder haben eine Vorbildfunktion für die Umsetzung von Prädatorenmanagement durch Jagd auf ihren Flächen. Gleichzeitig müssen Bund und Länder Prädatorenmanagement fördern, das zum Gelingen von Artenschutzprojekten beiträgt.
- Die Mittel der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) müssen auch für die Förderung jagdlicher Infrastruktur in der Agrarkulturlandschaft eingesetzt werden. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) ist hierfür der Rahmen zu schaffen, beispielsweise für die Förderung von Fangjagd.
- Grundsätzlich sollten Maßnahmen für den Artenschutz in Abläufe des jeweiligen Betriebes integrierbar sein und zum Teil deutlich besser honoriert und unbürokratisch umgesetzt werden, um einen längerfristigen Erhalt der entsprechenden Maßnahme zu ermöglichen. Eine Förderung muss planungssicher und langfristig kalkulierbar sein, damit sich Maßnahmen dauerhaft in der gängigen landwirtschaftlichen Praxis etablieren und Akzeptanz finden.
- Der Fokus bei Biodiversitätsmaßnahmen in der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU und der Mitgliedsstaaten, sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Säule, muss auf mehrjährigen Hegeflächen liegen. Mit diesen hochwirksamen Biodiversitätsmaßnahmen kann der größtmögliche Effekt für die Funktionsfähigkeit von Agrarökosystemen am flächenschonendsten erzielt werden. Einzelmaßnahmen sollten so flächig gestaltet und räumlich kombiniert werden, dass sie den fachlichen Anforderungen Rechnung tragen.
- Anlage und Erhalt von Brachflächen sollte zukünftig bis zu einem gewissen Maß wieder verpflichtend sein, um Offenlandarten (z.B. Feldhase, Rebhuhn und andere Feldvögel) sowie Insekten einen Ganzjahreslebensraum zu bieten. Dabei sollte der Anteil von Brachflächen so gestaltet werden, dass eine gleichmäßige Verteilung und Vernetzung von Biotopflächen in der intensiv genutzten Agrarlandschaft gewährleistet wird.
- Ausgleichszahlungen für verpflichtende Brachflächen müssen mindestens kostendeckend für die jeweilige Fläche sein. Die Förderung von freiwillig angelegten Brachflächen muss eine Biodiversitäts- und Standortkomponente enthalten.
- Zwischenfruchtmischungen haben ackerbauliche Vorteile, da mineralischer Stickstoffdünger eingespart werden kann. Vorteile für die Artenvielfalt gibt es nur, wenn eine mechanische Wildkräuterregulierung entfällt.
DJV-Delegiertenversammlung in Mainz, 22. Juni 2024