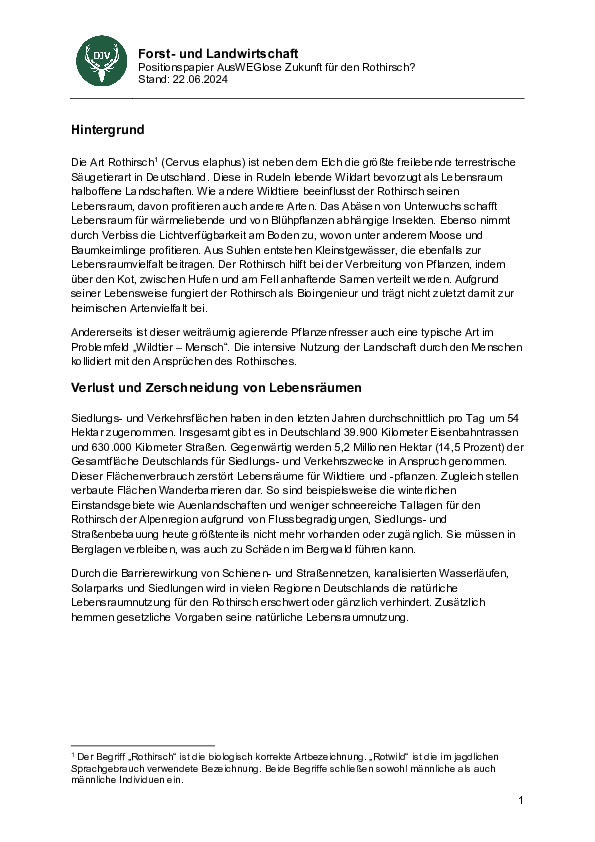DJV-Position zur Zukunft vom Rotwild

Hintergrund
Die Art Rothirsch1 (Cervus elaphus) ist neben dem Elch die größte freilebende terrestrische Säugetierart in Deutschland. Diese in Rudeln lebende Wildart bevorzugt als Lebensraum halboffene Landschaften. Wie andere Wildtiere beeinflusst der Rothirsch seinen Lebensraum, davon profitieren auch andere Arten. Das Abäsen von Unterwuchs schafft Lebensraum für wärmeliebende und von Blühpflanzen abhängige Insekten. Ebenso nimmt durch Verbiss die Lichtverfügbarkeit am Boden zu, wovon unter anderem Moose und Baumkeimlinge profitieren. Aus Suhlen entstehen Kleinstgewässer, die ebenfalls zur Lebensraumvielfalt beitragen. Der Rothirsch hilft bei der Verbreitung von Pflanzen, indem über den Kot, zwischen Hufen und am Fell anhaftende Samen verteilt werden. Aufgrund seiner Lebensweise fungiert der Rothirsch als Bioingenieur und trägt nicht zuletzt damit zur heimischen Artenvielfalt bei.
Andererseits ist dieser weiträumig agierende Pflanzenfresser auch eine typische Art im Problemfeld „Wildtier – Mensch“. Die intensive Nutzung der Landschaft durch den Menschen kollidiert mit den Ansprüchen des Rothirsches.
1Der Begriff „Rothirsch“ ist die biologisch korrekte Artbezeichnung. „Rotwild“ ist die im jagdlichen Sprachgebrauch verwendete Bezeichnung. Beide Begriffe schließen sowohl männliche als auch weibliche Individuen ein.
Verlust und Zerschneidung von Lebensräumen
Siedlungs- und Verkehrsflächen haben in den letzten Jahren durchschnittlich pro Tag um 54 Hektar zugenommen. Insgesamt gibt es in Deutschland 39.900 Kilometer Eisenbahntrassen und 630.000 Kilometer Straßen. Gegenwärtig werden 5,2 Millionen Hektar (14,5 Prozent) der Gesamtfläche Deutschlands für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen. Dieser Flächenverbrauch zerstört Lebensräume für Wildtiere und -pflanzen. Zugleich stellen verbaute Flächen Wanderbarrieren dar. So sind beispielsweise die winterlichen Einstandsgebiete wie Auenlandschaften und weniger schneereiche Tallagen für den Rothirsch der Alpenregion aufgrund von Flussbegradigungen, Siedlungs- und Straßenbebauung heute größtenteils nicht mehr vorhanden oder zugänglich. Sie müssen in Berglagen verbleiben, was auch zu Schäden im Bergwald führen kann.
Durch die Barrierewirkung von Schienen- und Straßennetzen, kanalisierten Wasserläufen, Solarparks und Siedlungen wird in vielen Regionen Deutschlands die natürliche Lebensraumnutzung für den Rothirsch erschwert oder gänzlich verhindert. Zusätzlich hemmen gesetzliche Vorgaben seine natürliche Lebensraumnutzung.
Folgen für den Rothirsch – genetische Verarmung
Menschliche Infrastruktur
Straßen, Siedlungen und Solarparks beeinträchtigen maßgeblich den genetischen Austausch zwischen verschiedenen Populationen. Mangelnder genetischer Austausch kann auf Dauer zu Inzuchterscheinungen führen und den Erhalt einer Population gefährden. Erste äußerlich erkennbare Inzuchterscheinungen wie Unterkieferverkürzungen wurden beispielsweise in Hessen beobachtet. Untersuchungen zeigen bereits eine verminderte genetische Variabilität. Auch in anderen Regionen Deutschlands wurde eine genetische Verarmung der Rothirschpopulationen nachgewiesen.
Amtlich festgesetzte Rotwildgebiete gibt es im Norden und Nordosten Deutschlands nicht, allerdings schränkt Infrastruktur auch dort die Wanderrouten und damit den genetischen Austausch zwischen Vorkommen stark ein.
Amtliche Rotwildbezirke
Obwohl der Rothirsch ein Bewohner der halboffenen Landschaft ist, wurden in westlichen und südlichen Bundesländern amtliche Rotwildbezirke in walddominierten Arealen eingerichtet – etwa in Baden-Württemberg seit 1958. Diese seit Jahrzehnten bestehenden Rotwildbezirke – und in Folge davon gesetzlich definierte rotwildfreie Gebiete – verhindern die natürlichen Wanderungsbewegungen und damit den nötigen genetischen Austausch. Zudem besteht in den betroffenen Bundesländern in der Regel ein Abschussgebot außerhalb der Rotwildgebiete, das vor allem die für den genetischen Austausch wichtigen wandernden Hirsche betrifft. Diese Vorgaben hemmen den Genfluss im Vergleich zu Gebieten, in denen sich Rotwild frei bewegen kann, stark. Im Rahmen der Novellierung des Landesjagdgesetzes in Rheinland-Pfalz ist die Auflösung der Rotwildbewirtschaftungsbezirke vorgesehen.
Fazit:
Landschaft ist eine begrenzte natürliche Ressource. Ihre nachhaltige Nutzung muss sowohl die Belange der Menschen als auch den Erhalt der heimischen Artenvielfalt berücksichtigen. Dies erfordert eine intelligente Planung. Die rigide Festlegung von Lebensräumen für das Rotwild widerspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem modernen Wildtiermanagement. Hingegen eignet sich der weiträumig agierende Rothirsch als Leitart für den überregionalen Biotopverbund im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 21).
Forderungen
- Das Bundesprogramms Wiedervernetzung, das bereits 2012 vom Bundeskabinett beschlossen wurde, muss konsequent und zügig umgesetzt werden. Bis 2030 müssen mindestens 100 Querungshilfen über das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) und das Bundesprogramm Wiedervernetzung gefördert werden. Denn ohne ausreichend Querungshilfen haben unsere Wildtiere keinen „Passierschein“ in die Zukunft.
- Deutschland ist verpflichtet, das auf EU-Ebene beschlossene Nature Restoration Law umzusetzen. Dabei müssen Wanderkorridore für den Rothirsch erhalten und wiederhergestellt werden.
- Die umgehende, wissenschaftlich begründete Auflösung amtlicher Rotwildbezirke und begleitend dazu die Entwicklung von Managementstrategien für das Rotwild mit dem Ziel, vitale Populationen als Teil der heimischen Artenvielfalt zu erhalten.
- Die sofortige Einrichtung von Länderarbeitsgruppen (Vertreter der Wissenschaft, Landnutzer, Verbände, Behörden) zur Entwicklung und Evaluierung geeigneter Managementstrategien.
- Eine Wildökologische Raumplanung muss im Spannungsfeld konkurrierender menschlicher Nutzungsinteressen die Bedürfnisse der Wildtiere sicherstellen. Sie kann als Planungs- und Steuerungsinstrument beispielsweise in Landschaftsrahmenplänen implementiert werden.
- Die Bejagung muss wildtierökologische sowie tier- und jagdethische Erfordernisse erfüllen und darf sich nicht einseitig an Nutzerinteressen orientieren. Das umfasst:
- eine naturnahe Geschlechter- und Altersstruktur (Erhalt der Sozialstruktur)
- ein Abschussverbot für wandernde Hirsche (wichtig für genetischen Austausch)
- die Wahrung des Elterntierschutzes (endet nicht mit der Säugezeit, sondern geht bis ins Folgejahr).
Verwendete Literatur
Balkenhol, N.; Westekemper, K. (2022): Auswirkungen der Landschaftszerschneidung auf den Rothirsch (Cervus elaphus) in Deutschland: eine landschaftsgenetische Studie. Abteilung Wildtierwissenschaften, Georg-August-Universität Göttingen.
Reimoser, F.; Hackländer, K. (2016): Wildökologische Raumplanung – Chancen und Grenzen. OÖ Jäger: 43-50.
Reiner, G.; Willems, H. (2021): Genetische Isolation, Inzuchtgrade und Inzuchtdepressionen in den hessischen Rotwildgebieten. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung Bd.46: 161 – 184.
DJV-Delegiertenversammlung in Mainz, 22. Juni 2024